Auch ein älterer Text, vieles echt, manches nicht. Vielleicht schreib ich es mal weiter
Es begann mit einem Blick.
Ich hatte ihn nicht kommen sehen. Er war einfach da – am Rand des Frühstücksraums, ein Glas in der Hand, sein Blick ruhig, direkt. Er sah mich an, ohne Hast, ohne die flüchtige Nervosität, mit der Männer normalerweise wegsehen, wenn man ihren Blick erwidert. Er tat es nicht. Und ich war es, die zuerst wegschauen musste. Nicht aus Scham, eher, weil etwas in mir zu vibrieren begann, leise, kaum merklich.
Ich sah ihn später wieder. Unten am Pool, dann noch einmal auf der Terrasse beim Kaffee. Wir wechselten keine Worte. Nur Blicke. Immer wieder. Und dann – fast beiläufig – stand er am Brotkorb neben mir. Die Wärme seines Körpers neben meinem. Keine Berührung. Aber ich roch ihn. Das war der Moment, den ich nicht vergaß.
Sein Aftershave war zurückhaltend, herb, fast zu elegant für diesen Ort. Es passte nicht zu Sonnencreme und Chlor, nicht zu der Routine des Hotelmorgens. Und doch blieb es haften – wie eine Erinnerung, die sich nicht an den Kopf, sondern an die Haut heftet.
Er sagte nichts. Und doch war der Moment zwischen uns nicht leer.
Erst am Abend sprach er mich an. Ich stand am Buffet, hielt Teller und Serviette, als mir die kleine weiße Ecke entglitt und zu Boden glitt. Ich beugte mich nicht. Da war er schon hinter mir. Ein leiser Hauch, seine Finger, die Serviette – und ein kurzes Tippen auf meine Schulter.
„Sie haben was verloren“, sagte er. Ruhig. Fast zu ruhig.
Ich drehte mich um, nahm sie entgegen, murmelte ein Danke. Und wieder war da dieser Blick. Etwas zwischen einem Lächeln und einem Test. Ich spürte, dass ich mich bewegen sollte. Weggehen. Ich tat es nicht sofort.
Am nächsten Morgen stand er plötzlich hinter mir. Wieder am Buffet. Ich erkannte ihn nicht sofort, hörte nur seine Stimme.
„Guten Morgen“, sagte er.
Und seine Hand – flach, warm – legte sich an meinen unteren Rücken. Nicht drängend. Nur ein Hauch zu lange für bloße Höflichkeit. Ich erstarrte nicht. Ich atmete einfach nur flacher. Und stand da.
Erst später an diesem Tag, als wir uns wieder begegneten – diesmal draußen, beim Abendessen unter freiem Himmel, passierte es. Ich stand bei den kalten Platten, gerade dabei, etwas Lachs auf meinen Teller zu schieben, als er wieder hinter mir war.
Dicht. So dicht, dass ich ihn spürte. Erst sein Atem. Dann seine Hüfte – oder mehr.
Es war kein Stoß, keine plumpe Bewegung. Eher ein Innehalten. Eine Einladung, in der nichts gesagt, aber alles deutlich war.
Und mein Körper, längst hellwach, tat nichts. Er blieb einfach stehen. Und wartete.
Ich wusste nicht genau, was mit mir geschah.
Da war keine klare Absicht, kein Plan, kein inneres „Ich will das.“ Und doch war ich hellwach. Nicht nervös – eher… leicht verschoben. Wie wenn man lange in einem warmen Raum war und plötzlich frische Luft einatmet.
Er war mir fremd, und doch war da diese Vertrautheit in seiner Art, mich anzusehen. Kein Lächeln, keine aufgesetzte Freundlichkeit – nur ein Blick, der nicht auswich, wenn sich unsere Augen trafen. Als würde er einfach wissen, dass ich es merkte. Dass ich nicht aus Gewohnheit hinsah, sondern weil ich es wollte.
Ich ertappte mich dabei, wie ich anfing, ihn zu suchen. In der Menge. Beim Kaffeeholen. In der Spiegelung der Fenster. Immer nur kurz. Immer so, dass es niemand merkte. Nicht mal ich selbst.
Was mich verwirrte, war nicht sein Blick. Nicht seine Nähe. Sondern das, was es mit mir machte.
Wie mein Körper schneller reagierte, als ich denken konnte. Wie ich plötzlich mein eigenes Haar im Nacken spürte. Den Stoff meines Kleides auf der Haut. Das leichte Zittern meiner Hand, als ich nach dem Löffel griff.
Ich fühlte mich nicht „verführt“. Es war nichts Plötzliches. Eher ein langsames, stilles Verrücken der Grenze zwischen dem, was war, und dem, was möglich schien.
Er gefiel mir. Sehr sogar. Nicht nur, wie er aussah – obwohl auch das mich traf: das kantige Profil, die Ruhe in seinen Bewegungen, das dunkle Haar, ein paar Strähnen in Grau. Nein, es war diese Klarheit in ihm. Dieses Fast-nichts-Sagen und doch alles spüren lassen.
Ich hatte keine Worte dafür. Nur ein wachsendes, leises Bedürfnis, ihn wiederzusehen. Ihn aus der Nähe zu erleben.
Nicht aus einem Mangel heraus. Sondern aus einem Verlangen, das in mir aufstieg wie warme Luft – langsam, unaufhaltsam. Und plötzlich spürte ich: Es ging längst nicht mehr nur um ihn.
Es ging um mich.
Die Nachmittagssonne lag glühend über dem Hotelgelände, doch das Wasser im Pool war kühl. Ich stieg langsam hinein, während mein Mann sich auf eine der Liegen setzte – das Tablet in der einen, ein Fruchtsaft in der anderen Hand, die Kinder planschend vor ihm, halb im Blick, halb entglitten.
Ich ließ mich treiben. Wortlos. Nur mit den Augen suchend. Und dann sah ich ihn.
Er stand am Beckenrand auf der anderen Seite, halb im Schatten, das Handtuch lässig über der Schulter. Als ich auftauchte, blickte er direkt zu mir. Kein Zögern. Kein Versuch, den Moment zu tarnen. Nur ein Hauch von Lächeln – und ein Blick, der ganz kurz über meinen Körper glitt.
Er trat näher ans Becken, langsam, wie ohne Ziel – und doch war es klar, dass ich es war, auf die er zuging. Mein Herz pochte spürbar gegen meinen Badeanzug, und ich konnte nichts dagegen tun. Oder wollte es nicht.
Ich richtete mich auf, lehnte mich leicht an den Rand. Die Nässe auf meiner Haut machte den Stoff meines Badeanzugs dunkler, dichter. Und ich spürte sie – meine Brustwarzen. Hart. So eindeutig, dass ich kurz innehielt, meine Schultern etwas hob, versuchte, es zu ignorieren. Vergeblich.
Ich sah seinen Blick – zuerst kurz über meine Brust, dann direkt in meine Augen. Keine platte Gier. Kein schamloses Starren. Sondern etwas viel Aufregenderes: Aufmerksamkeit. Interesse. Bewusste Wahrnehmung.
Sein kleines, kaum sichtbares Lächeln traf mich wie eine Berührung. Und dann dieser Blick. Tief. Offen. Wie eine Frage, die schon längst eine Antwort kannte.
Ich lachte leise, fast unwillkürlich. Und sah weg. Nur für einen Moment.
Mein Mann winkte mich zu sich, bat mich, kurz nach den Kindern zu sehen. Ich ging hin, lächelte, griff nach einem der nassen Handtücher, hörte meinem Sohn zu, wie er mir von einem Spiel erzählte – aber mein Inneres war nicht mehr dort.
Ich spürte immer noch seinen Blick.
Und das leise Knistern auf meiner Haut wollte nicht vergehen.
Ich glitt wieder ins Wasser, langsam, mit Bedacht – nicht, weil ich beobachtet werden wollte, sondern weil ich es spürte: Jede Bewegung, jeder Muskel in mir war aufgeladen. Die Sonne brannte, aber sie war nichts gegen das, was unter meiner Haut loderte.
Er war im Becken. Weiter vorn, im flachen Bereich, als ich mich hineingleiten ließ. Nicht zu nah. Nicht aufdringlich. Und doch fühlte ich, wie sich unsere Kreise leise berührten.
Ich tat, als würde ich nur schwimmen. Nur abtauchen. Nur gleiten. Aber mein Körper war wach. Und ich wusste, dass er mich sah. Nicht einfach ansah – nein, er sah mich. Mit einer Intensität, die fast körperlich war.
Ich drehte mich leicht im Wasser, glitt an ihm vorbei – nicht zu nah, aber nah genug. Und als ich wieder auftauchte, fühlte ich es: seinen Blick auf mir. Kein hastiges Gieren. Kein Verstecken. Er betrachtete mich, Stück für Stück.
Meine Brüste, unter dem feuchten, klebenden Stoff. Meine Hüften. Der leichte Schatten zwischen meinen Schenkeln. Ich hätte empört sein müssen. Ich hätte mir wünschen sollen, dass er wegschaut. Aber mein Körper wollte nichts davon.
Im Gegenteil.
Meine Haut spannte sich. Ich fühlte, wie meine Brustwarzen hart blieben, herausragten, fast trotzig. Und das Gefühl zwischen meinen Beinen wurde schwer. Wärme, Druck, ein inneres Ziehen, das ich kaum noch wegatmen konnte.
Ich blickte zu ihm – bewusst. Und ja, ich sah es: dieses feine Spiel aus Zurückhaltung und Hunger in seinen Augen. Als würde er nur das sehen, was ich ihm erlaubte – und doch mehr spüren, als ich zeigen wollte.
Ein Tropfen lief mir von der Schläfe über den Hals. Ich wischte ihn weg. Und wusste genau, wie seine Augen sich an meiner Bewegung festhielten.
Und da war es.
Kein Wort. Keine Berührung. Und doch war es so, als hätte er mich längst berührt. Mit seinem Blick. Mit seiner Präsenz. Mit dieser leisen, ungeheuren Lust, die sich in mir ausbreitete wie eine warme Welle, tief, schamlos, schön.
Ich spürte mich selbst nicht mehr nur von außen. Ich fühlte mich – im Innersten.
Und wusste: Wenn er jetzt näher käme, wenn er nur ein kleines Stück näher käme… ich würde nicht zurückweichen.
Er war plötzlich näher. Nicht auffällig – nur ein, zwei Züge im Wasser, ein langsamer Schritt durch das Becken. Vielleicht tat er so, als würde er einfach nur die Sonne meiden, den Schatten suchen, abkühlen.
Aber ich wusste es. Ich fühlte es.
Ich stand halb im Wasser, das mich bis zur Taille umspülte. Die Kacheln des Beckenrands unter meinen Fingern, mein Blick auf den glitzernden Spiegel vor mir. Ich hörte irgendwo die Stimme meines Mannes, ein Kinderlachen – wie durch Watte. Alles andere war verschwommen.
Er schwamm an mir vorbei. Langsam. So nah, dass ich den Sog seines Körpers spürte. Und dann – ganz beiläufig – sein Arm, der sich beim Vorbeiziehen an meinem Rücken entlangschob. Nur ein Streifen Haut. Warm. Nass. Und so ruhig, so selbstverständlich, dass es wie ein Versehen hätte wirken können.
Aber es war keins.
Ich zuckte nicht. Ich tat nichts. Ich ließ es zu.
Er tauchte neben mir auf, schüttelte sich das Wasser aus dem Gesicht, fuhr sich durch die Haare – ganz ruhig. Und blieb dann stehen. Seitlich. Nah genug, dass unsere Schultern sich fast berührten.
„Heiß heute,“ sagte er. Nur das.
Ich nickte. Meine Stimme wäre mir in der Kehle stecken geblieben, hätte ich versucht, etwas zu sagen.
Dann spürte ich es.
Seine Hand – ganz leicht – an meiner Hüfte. Nicht aufdringlich. Kein Greifen. Nur ein sanfter Druck mit der flachen Hand, als wolle er sich für einen Moment orientieren, das Gleichgewicht halten.
Aber ich wusste es besser.
Ich spürte, wie mein ganzer Körper darauf reagierte. Mein Atem wurde flacher. Meine Haut zog sich zusammen, als hätte er sie überall berührt. Mein Unterleib spannte sich an, unkontrolliert, wie ein Zucken tief in mir.
Und dann – fast gleichzeitig – sein Blick. Unten. Direkt. Ein kurzer, messerscharfer Moment, in dem ich wusste: Er sah es. Alles.
Den Stoff, der sich zwischen meinen Beinen leicht spannte. Die Nässe, die nicht nur vom Wasser kam. Die Härte meiner Brustwarzen, die sich gegen das Lycra drückten.
Und ich?
Ich sah ihn an. Direkt. Offen. Und ich ließ es zu.
Ich hätte etwas sagen können. Ich hätte gehen können.
Aber ich stand da.
Und wollte mehr.
Er blieb neben mir. Kein Wort. Kein Lächeln mehr. Nur diese Nähe, die elektrischer war als jede Berührung.
Ich wusste nicht mehr, wie viel Zeit verging. Vielleicht waren es Sekunden. Vielleicht Minuten. Alles um uns herum war in Watte gehüllt: das Plätschern, die Stimmen, das Leben am Beckenrand.
Und dann, ganz beiläufig, stieß er sich vom Beckenrand ab – als wolle er abtauchen, ein paar Züge schwimmen. Ich sah ihm hinterher, wie sein Körper durchs Wasser glitt. Breit, kräftig, ruhig.
Er drehte sich. Kam zurück. Langsam. Direkt auf mich zu.
Ich blieb dort, wo ich war. Auf halbem Weg zwischen Wand und Mitte. Im tieferen Wasser, wo die Füße gerade noch den Boden berührten.
Er tauchte ein letztes Mal ab. Ich sah die Bewegung unter der Wasseroberfläche, das Schimmern seiner Haut. Und dann – spürte ich ihn.
Seine Hand, ganz plötzlich, an meiner Wade.
Ich erschrak nicht. Ich hielt die Luft an.
Die Hand glitt höher. Mein Bein entlang, ruhig, forschend. Dann – mein Oberschenkel.
Mein Körper spannte sich an, ein scharfes Zittern zuckte durch mich. Ich sah nach unten, durch das flirrende Blau, und da war er – unter mir. Seine Augen geöffnet. Sein Blick glitt über mich. Nicht verstohlen – offen.
Dann seine Hand, die sich ganz langsam seitlich um meine Hüfte legte, knapp unter dem Badeanzug. Nicht dort, wo es hätte auffallen können. Gerade dazwischen. Der Punkt, an dem eine Berührung alles verändert.
Ich spürte, wie meine Scham sich zusammenzog. Eine feuchte, brennende Hitze breitete sich in mir aus, die nichts mit dem Wasser zu tun hatte.
Meine Finger krallten sich leicht in den Beckenrand. Ich blickte hinüber, suchte meinen Mann – dort, wo er mit den Kindern spielte. Noch da. Noch abgelenkt. Noch fern genug.
Dann kam er wieder hoch. Direkt vor mir. Unser Gesicht nur eine Handbreit voneinander entfernt.
„Geht’s?“ fragte er, als wäre nichts gewesen.
Ich nickte. Doch ich fühlte, wie meine Beine nachgaben.
Und ich wusste: Wenn er mich jetzt noch einmal berührte, noch ein bisschen näher käme – ich würde mich nicht mehr halten können.
Ich hatte die Augen geschlossen, mein Körper halb ausgestreckt am Rand des Pools, als ich ihn spürte – wieder. Nicht sehen, nur fühlen: die Bewegung im Wasser, die leichte Veränderung der Temperatur, der Schatten, der näherkam.
Als ich die Augen öffnete, stand er über mir. Tropfnass. Breit. Ruhig. In seiner Hand ein Cocktail – hoch, schmal, golden schimmernd, mit einer dünnen Limettenscheibe und einem langen, weißen Trinkhalm.
Er stellte das Glas neben mich auf die warme Poolkante. Dann – wie beiläufig – seine Zimmerkarte daneben.
„Dachte, du brauchst etwas Kühles zwischen den Lippen“, sagte er.
Ich richtete mich langsam auf. Meine Brüste schoben sich über den Wasserspiegel, nass und eng vom Stoff umhüllt. Ich sah ihm in die Augen, dann zum Glas, das so unverhohlen wie ein Angebot zwischen uns stand.
„Ist das… für mich?“ fragte ich.
„Würde ich dir sonst was Hohes, Kaltes, Glitschiges in die Hand drücken?“
Ich lachte leise. Aber meine Kehle war trocken. Ich nahm das Glas – schmal, lang, feucht. Meine Finger glitten daran hinab. Ich konnte nicht anders, als den Halm zwischen die Lippen zu nehmen, langsam, wie aus Instinkt.
Ich sog daran.
Seine Augen folgten jeder Bewegung meiner Lippen. Kein Lächeln diesmal. Nur Hitze.
„Schmeckt’s?“ fragte er.
Ich nickte, ließ den Halm kurz zwischen meinen Zähnen ruhen.
„Süß. Weich. Und irgendwie… gefährlich.“
„Wie du?“
Ich hielt inne. Lächelte. „Ich beiß aber, wenn man zu gierig ist.“
„Ich riskier’s.“
Ich leckte einen Tropfen vom Rand des Glases, ohne es bewusst zu wollen. Und spürte seine Reaktion, ohne dass er sich rührte – nur in der Art, wie seine Atmung minimal tiefer wurde.
Dann sah er mir direkt in die Augen.
„Und? Bist du eher jemand, der trinkt… oder der genießt?“
„Kommt drauf an, wer’s mir reicht.“
Seine Hand tauchte kurz ins Wasser, nur um sich zu kühlen – oder um zu berühren? Ich wusste es nicht. Ich sah, wie seine Finger meine Nähe streiften. Wie die Tropfen über seinen Unterarm liefen. Und ich stellte mir vor, wie sie auf meinen Bauch tropften.
„Und bist du jemand, der gern probiert, was anderen gehört?“ fragte ich, halb im Scherz, halb zitternd.
„Nur wenn ich weiß, dass es mir schmecken würde. Und dass es heimlich serviert wird.“
Mein Atem ging schneller. Ich lehnte mich zurück, zog das Glas mit mir. Der Halm rutschte zwischen meine Lippen, und ich ließ ihn absichtlich etwas tiefer gleiten. Ein Spiel. Ein Test. Und ich wusste, dass er es verstand.
Er trat näher, das Wasser an seinem Körper glänzte im Licht. Seine Augen glitten über meinen Hals, meine Brüste – wo die Kälte des Drinks meine Brustwarzen noch fester gemacht hatte. Der Stoff spannte sich.
Er sah es. Und blieb dort mit seinem Blick. Einen Moment zu lang. Dann sah er mir wieder in die Augen.
„Wenn ich dein Glas wäre“, sagte er leise, „ich würde hoffen, dass du nie aufhörst zu trinken.“
Ich spürte, wie mein Unterleib zu pochen begann. Eine Hitze, schwer, süß, pulsierend. Ich wollte etwas sagen – irgendetwas – doch mein Körper war schneller als mein Verstand.
Ich beugte mich leicht vor, hauchte: „Vielleicht wirst du’s ja. Wenn du nicht vorher schmilzt.“
Er lächelte. Diesmal nur mit einem Mundwinkel. Dann griff er nach dem Handtuch, wickelte es um seine Hüften, trat einen Schritt zurück.
„Ich geh mal. Nicht, dass das Wasser hier zu heiß wird.“
Er sah mich an. Offen. Nicht fragend. Nicht fordernd. Einfach wissend.
Dann – fast beiläufig – ließ er die Karte auf der Kante liegen. Weiß. Kühl. Deutlich.
Zimmer 314.
„Man sieht sich“, sagte er. Und war weg.
Ich starrte auf das kleine Rechteck. Auf die Zahl. Auf das Wasser, das meinen Körper nicht mehr kühlte.
Ich war heiß. Tief. Unten. Und jede Faser in mir wusste: Wenn ich jetzt nichts tue… verbrenne ich vielleicht an mir selbst.
Ich war allein. Nicht wirklich – Menschen lachten, spritzten, redeten, lebten ringsum. Mein Mann war ein paar Meter entfernt, kniete sich zu unserer Tochter, wischte ihr Wasser aus dem Gesicht. Ich nickte ihm zu, zwang ein Lächeln – mein Körper aber gehörte mir längst nicht mehr.
Ich blieb im tieferen Teil des Beckens, das Gesicht halb zur Sonne gedreht. In mir tobte ein Drang, ein Flirren, das mit jeder Bewegung des Wassers stärker wurde.
Die Karte lag nicht mehr da. Ich hatte sie mit einem schnellen Griff vom Beckenrand genommen, verstohlen, fast wie in Zeitlupe. Jetzt steckte sie tief in meinem Badeanzug, zwischen Brust und Stoff gepresst. Ich spürte sie wie ein Puls.
Ich glitt tiefer ins Wasser. Langsam. Mein Körper war heiß, zwischen den Beinen feucht auf eine Weise, die nichts mit dem Pool zu tun hatte.
Ich schwamm zur anderen Seite, dorthin, wo ein breiter, starker Wasserstrahl an der Poolwand herausströmte – ein Massagepunkt, offiziell gedacht für Rücken oder Nacken.
Ich wusste es besser.
Ich stellte mich davor. Ließ mich treiben. Das Wasser umspülte mich, dann fand ich den Winkel – einen winzigen Moment der Justierung. Der Strahl traf mich leicht unterhalb der Hüfte. Ich atmete ein. Dann etwas tiefer. Noch ein Schritt, bis der Druck genau an dem Punkt auftraf, wo sich all die Spannung in mir sammelte.
Meine Schenkel zuckten leicht.
Ich sah mich um. Niemand achtete auf mich. Ich bewegte mich kaum. Nur mein Atem ging schneller. Mein Becken leicht vorgeneigt, meine Augen halb geschlossen.
Der Druck war intensiv. Direkt. Ich spürte, wie sich meine Scham öffnete, wie mein Körper sich spannte, forderte, fast weinte vor Lust.
Dann – wie ein Blitz – spürte ich ihn wieder.
Ich sah nach rechts. Und da war er.
Im Schatten eines Baumes. Halb verdeckt. Lässig an einen weißen Sonnenschirm gelehnt. Sein Blick direkt auf mir.
Und er wusste es. Alles.
Er grinste nicht lüstern. Kein billiges Grinsen. Nein – es war tiefer. Breiter. Ein Grinsen, das sagte: Ich sehe dich. Ich kenne dich. Ich weiß, was du tust. Und ich will, dass du weitermachst.
Ich konnte nicht aufhören. Meine Muskeln zogen sich zusammen. Meine Beine wurden weich, mein Becken hart. Und in mir – dieser Moment: das Lösen, das Zerreißen, das scharfe Kommen, das fast still war und doch durch Mark und Bein ging.
Ein Laut stieg in meiner Kehle auf – aber ich schluckte ihn runter, wandte den Kopf zur Seite, als würde ich mich nur nach der Sonne recken.
Meine Finger krallten sich unter Wasser in die Kante. Ich kam. Still. Tief. Zitternd.
Und als ich wieder hinsah – war er verschwunden.
Kein Schatten mehr. Kein Blick. Nur das leise Nachbeben in mir. Und die Karte, kühl und eckig, gegen meine Haut gedrückt.
Ich atmete durch. Langsam. Tief. Dann schwamm ich zurück.
Mein Mann winkte mich heran. Ich ging zu ihm, küsste flüchtig seinen Kopf, setzte mich zu den Kindern, nahm das Handtuch. Alles war normal. Aber nichts war wie vorher.
In meinem Kopf nur eine Frage:
Würde ich ihn wiedersehen? Oder eher: … würde ich hingehen?
Ich wusste es schon am Nachmittag. Noch bevor ich kam, noch bevor ich seine Zimmerkarte in meinen Badeanzug geschoben hatte.
Ich würde einen Weg finden.
Und so ließ ich meine Sonnenbrille ganz beiläufig unter einem der Liegestühle verschwinden. Tief zwischen die Streben geschoben, so dass sie nicht sofort auffiel. Niemand merkte etwas. Nicht mein Mann. Nicht die Kinder. Nur ich wusste, dass dieser kleine, einfache Gegenstand mein Freifahrtschein war.
Der Rest des Tages verging wie im Nebel. Lachen, Duschen, Sonnencreme. Dann das Abendessen. Laut, bunt, wie immer. Ich saß meinem Mann gegenüber, mein Kleid aus dünnem Stoff klebte leicht an der Haut, meine Gedanken weit weg – oben, in Zimmer 314.
Er war liebevoll. Aufmerksam. Legte mir die Hand auf das Knie, küsste mich auf die Wange, während die Kinder ein Eis schleckten. Ich lächelte. Ich antwortete. Und in meinem Innersten bebte es.
Als wir zurück im Zimmer waren, lagen die Kinder schon schläfrig in ihren Betten. Die Klimaanlage summte leise. Mein Mann war im Bad. Ich stand am Fenster, das Licht ausgeschaltet, das Kleid an mir klebend.
Ich sah mein Spiegelbild – und wusste, was ich tat.
In meinem Kopf hatte ich es längst geplant. Ich würde gehen. Nicht lang. Nur kurz.
„Ich hab meine Sonnenbrille am Pool liegen lassen“, sagte ich, als er zurückkam. Ich klang beiläufig. Fast ärgerlich. „Die teure. Ich glaub, sie liegt noch unter dem Liegestuhl. Ich geh kurz runter.“
Er sah mich an, leicht überrascht. Dann lächelte er.
„So spät noch? Im Dunkeln? In dem Kleid? Du siehst aus wie aus einem Film…“
Er trat näher, strich mir über den Nacken. Seine Finger waren warm. Vertraut. Und in diesem Moment, in dem er mir ein Kompliment machte, in dem seine Stimme weich war und voller Zuneigung – stellte ich mir etwas anderes vor.
Seine Stimme.
Der andere. Der Unbekannte. Wie er mir im Flur die Wand im Rücken gibt. Wie sein Atem mein Ohr trifft. Seine Stimme rau, unverschämt leise.
„So würd ich dich gern ausziehen.“ „Oder einfach nur anbehalten und unter den Stoff fassen.“ „Wetten, du bist schon nass?“
Mein Atem stockte. Mein Mann sagte irgendetwas weiter – ich hörte es nicht. Denn in meinem Inneren geschah etwas Unerhörtes.
Ein Zucken tief in mir. Ein Schwall von Wärme, flüssig, süß, schwer. Ich spürte die Nässe zwischen meinen Schenkeln – nicht schwach, nicht zart, sondern unübersehbar. Meine Muschi war offen, bereit, voll.
Ich drehte mich weg.
„Bin gleich zurück“, sagte ich. Ich küsste ihn, schnell, zu schnell. Und trat aus dem Zimmer.
Mein Kleid war sorgfältig gewählt – locker genug, um zu schweben, eng genug, um meinen Po zu zeichnen. Darunter: nichts. Kein Slip. Kein BH. Nur ich, mein pochendes Herz, und die Karte in meiner Hand.
Ich ging. Den Gang entlang. Die Luft kühl auf meiner Haut. Und mit jedem Schritt stieg die Frage in mir auf – heiß, scharf, unbarmherzig:
Was würde er mit mir tun, wenn ich anklopfte?
Und noch schlimmer: Was würde ich ihm erlauben?
Ich stand vor der Tür.
Der Gang war still, in sanftes Licht getaucht. Ich hörte leise Musik aus der Ferne, das Klacken von Geschirr aus der Bar unten. Aber hier war alles weich, gedämpft – als hätte das Hotel geahnt, dass dieser Moment nicht gestört werden darf.
Ich hielt die Karte in der Hand. Die Zahl: 314. Mein Daumen strich darüber. Ich hatte nicht geklopft. Noch nicht. Ich atmete flach. Mein Kleid, das leichte Sommerding, klebte an meinem Rücken. Ich spürte die Nässe an meinen Schenkeln – feine Lusttröpfchen, die ich nicht mehr aufhalten konnte.
Ich hatte kein Höschen an. Kein Schutz. Kein Halt. Nur Haut, Hitze und der Gedanke an ihn.
Was würde ich sagen? Sollte ich überhaupt etwas sagen? Würde er öffnen – schweigend – mich nur ansehen, mich wortlos eintreten lassen?
Ich stellte mir vor, wie er hinter der Tür stand. Vielleicht nackt. Vielleicht im Hemd. Vielleicht mit nichts als einem Glas in der Hand.
Vielleicht hatte er es gewusst. Dass ich kommen würde. Vielleicht war er sicherer als ich – in all dem, was unausgesprochen war.
Ich hob die Hand. Fingernägel auf Holz. Zögernd. Dann: einmal klopfen. Nicht laut. Aber deutlich.
Eine Sekunde. Zwei. Drei.
Mein Herz raste. Ich hörte es in meinen Ohren, in meinem Hals, zwischen meinen Beinen. Mein Körper war flüssig geworden, aufgeladen. Alles an mir war wach. Offen. Bereit.
Dann: Schritte.
Langsam. Keine Hast. Dann: das Klicken des Schlosses.
Die Tür öffnete sich. Nur einen Spalt. Licht fiel hinaus, warm, goldfarben.
Und da war er.
Er trug nichts als eine locker gebundene Hotel-Bademanteljacke. Offen an den Waden, das Schlüsselbein nackt, seine Haut noch warm vom Duschen.
Er sah mich an. Nicht überrascht. Kein Wort. Nur dieser Blick.
Ein Hauch eines Lächelns. Eine Einladung – keine Frage.
Er trat einen Schritt zurück. Die Tür öffnete sich weiter. Und ich?
Ich stand noch. Einen Herzschlag lang.
Dann trat ich über die Schwelle.
Die Tür schloss sich hinter mir – leise, gedämpft. Ein kaum hörbares Klick, das sich in meinen Bauch senkte wie ein Schlussakkord.
Er trat nicht näher. Noch nicht.
Das Licht war weich, gedimmt, als hätte er es extra so vorbereitet. Die Luft war still, nur der leise Duft nach Duschgel und irgendetwas Männlichem – Holz, Wärme, etwas Vertrautes.
Ich blieb stehen. Spürte, wie mein Kleid über meine Oberschenkel strich, hauchdünn wie Haut. Darunter war nichts. Und das wusste ich jetzt bei jedem Atemzug.
Er sah mich einfach an. Von Kopf bis Fuß. Kein hektisches Abtasten – nur eine ruhige, prüfende Wahrnehmung. Als hätte er sich diese eine Minute lang vorgestellt, wie ich hier stehen würde. Und jetzt vergleiche er das Bild mit der Wirklichkeit.
Ich spürte, wie meine Brustwarzen hart wurden. Wieder. Schmerzhaft fast, so straff drückten sie sich gegen den Stoff. Ich machte keine Bewegung, aber mein Atem verriet mich. Meine Schenkel – feucht. Meine Knie – weich.
Dann sprach er. Leise. Ohne jede Eile.
„Ich wusste, du kommst. Irgendwann.“
Ich schluckte. Meine Stimme war kaum hörbar. „Ich hab meine Sonnenbrille verloren.“
Sein Blick glitt über mein Gesicht, mein Hals, dann tiefer. „Die scheinst du nicht zu brauchen. Du siehst sehr genau.“
Ich trat einen Schritt ins Zimmer. Der Boden war kühl unter meinen Fußsohlen. Meine Finger lagen auf meiner Hüfte, wie zur Tarnung, aber ich spürte, dass sie zitterten.
„Willst du was trinken?“ fragte er.
Ich schüttelte den Kopf.
„Dann sag mir, warum du wirklich da bist.“
Ich schwieg. Weil ich es nicht in Worte fassen konnte. Weil mein Körper es längst schrie.
Er trat näher. Nur ein Schritt. Ich spürte die Wärme seiner Haut. Nicht an meiner, noch nicht – aber nah genug, dass mein Atem flacher wurde.
Dann senkte er die Stimme. Nur ein Hauch:
„Du bist nass.“
Ich zuckte. Mein Blick schnellte zu ihm.
„Vom Pool“, flüsterte ich.
Sein Lächeln war langsam. Tief. Einverstanden. Aber nicht überzeugt.
Er beugte sich leicht vor. Nicht, um mich zu berühren. Nur, um mir etwas ins Ohr zu sagen.
„Nein. Nicht vom Pool. Sondern weil du hier bist. Weil du weißt, dass ich dich will. Und weil du es auch willst.“
Ich spürte es. Einen Tropfen. Warm. Direkt zwischen meinen Beinen.
Ich schloss die Augen. Für einen Moment. Und ließ den Gedanken zu: Ich bin genau da, wo ich sein will.
Er flüsterte weiter. „Sag mir, was du willst. Oder ich zeig’s dir.“
Ich öffnete die Augen. Sah ihn an. Und flüsterte zurück.
„Zeig es mir.“
„Zeig es mir“, hatte ich gesagt. Und es war, als hätte ich damit einen unsichtbaren Schlüssel umgedreht.
Er trat ganz nah an mich heran. Ich spürte seine Wärme, bevor ich ihn überhaupt berührte.
Dann legte er eine Hand auf meine Hüfte. Nur dort. Still. Flach. Kein Griff, kein Ziehen. Einfach nur ein Handteller auf Haut – durch das dünne Kleid hindurch.
Mein Atem stockte. Ich schloss die Augen. Und wartete.
Seine andere Hand hob sich – langsam. Fingern, die über meinen Oberarm glitten. Nichts forderndes. Nur ein Streifen. Ein erstes, tastendes „Ich will dich fühlen“.
Ich öffnete die Augen. Unsere Münder nur Zentimeter voneinander entfernt. Ich sah seine Pupillen – weit, dunkel.
Dann senkte er den Blick. Und schob das Kleid langsam an meiner Hüfte zur Seite. Nur ein kleines Stück. Eine Spur Haut, die freigelegt wurde.
Ich spürte die Luft. Kälter als seine Hand.
Seine Finger glitten von der Hüfte über meinen Oberschenkel, tastend, als wolle er prüfen, wie weit meine Haut ihn ließ.
Ich spannte mich leicht an. Nicht aus Angst – sondern weil mein Körper sich gegen das Warten wehrte.
Dann streifte seine Hand meinen inneren Oberschenkel. Warm. Breit. Langsam.
Meine Knie zitterten leicht. Ich wollte mich bewegen – nach vorn, zu ihm. Aber ich hielt still. Ich war sein. Jetzt schon. Und er wusste es.
„Du zitterst“, flüsterte er.
Ich nickte. Mehr konnte ich nicht.
Seine Finger stiegen höher. Zentimeter um Zentimeter. Bis sie den Saum meines Kleides wieder fanden. Aber diesmal an der Innenseite.
„Du trägst nichts drunter“, sagte er. Kein Vorwurf. Nur eine Feststellung. Eine Anerkennung.
Ich flüsterte: „Nein.“
Sein Mund kam näher. Streifte mein Ohr.
„Gute Entscheidung.“
Dann schob er das Kleid höher. Ganz langsam. Bis die Luft meine Scham traf. Und seine Finger – vorsichtig, tastend – den ersten Kontakt fanden.
Ein Streifen. Ein Zucken. Ein schmaler Druck, feucht.
Ich keuchte. Kurz. Scharf. Meine Hand fuhr an seine Schulter, nicht um ihn wegzuschieben – sondern um mich zu halten.
„Sag mir, wie feucht du bist“, flüsterte er.
Ich stöhnte fast. Nur ein Laut, ein Einverständnis.
Er strich mit zwei Fingern über meine Spalte. Langsam. Und ich spürte, wie mein Saft an seiner Haut kleben blieb.
„So feucht“, sagte ich.
Er hob die Finger. Führte sie zwischen unsere Gesichter. Und ließ mich zusehen, wie er sie sich langsam auf die Lippen legte.
„Wie ich’s mag“, sagte er leise.
Und ich war nicht mehr ich. Ich war Hitze, Lust, Gehorsam und Gier – alles zugleich.
Dann flüsterte er:
„Dreh dich um.“
Ich zögerte nicht. Mein Körper war schneller als mein Verstand. Ich drehte mich. Langsam.
Meine Hände fanden Halt an der Wand neben der Tür – kühle, glatte Oberfläche. Ich lehnte meine Stirn kurz dagegen, atmete tief durch. Mein Rücken zu ihm. Mein Po freigelegt unter dem Kleid, das jetzt hochgeschoben über meiner Taille ruhte.
Ich hörte ihn hinter mir. Kein Wort. Nur Atem.
Dann seine Hand. Flach auf meinem unteren Rücken. Ruhig. Besitzergreifend.
Seine Finger glitten über die Wirbelsäule, bis zu meinem Steiß. Dann – tiefer.
Ich spreizte instinktiv die Beine etwas. Ganz leicht. Gerade genug, um zu sagen: Ich will.
Sein Atem war jetzt näher. Ich spürte ihn an meiner Schulter, meinem Nacken. Und dann – seine Finger zwischen meinen Schenkeln.
Langsam, warm, feucht.
Er fuhr mit zwei Fingern durch meine Spalte. Nicht hastig. Kein Ziel. Nur spüren.
Ich stöhnte leise. Es war nicht kontrollierbar. Meine Stirn drückte sich fester gegen die Wand, meine Beine bebten.
„Offen“, flüsterte er. „So offen.“
Ich wollte antworten. Konnte nicht. Mein Mund war trocken, meine Kehle zugeschnürt vor Lust.
Dann, ganz plötzlich, sein Mund an meinem Nacken. Ein Hauch, ein Kuss, fast nur eine Berührung. Aber mein ganzer Körper zog sich zusammen.
„So heiß…“
Seine Hand bewegte sich tiefer. Zwei Finger glitten über meine Öffnung, spielten mit ihr, ohne einzudringen. Er reizte. Dehnte. Neckte.
Ich drückte mich unbewusst zurück – suchte mehr. Er hielt mich fest. Mit der anderen Hand, fest auf meiner Hüfte.
„Geduld“, hauchte er. „Du bist doch gekommen vorhin… jetzt lässt du mich bestimmen, wann du wieder darfst.“
Ich stöhnte. Ein geflüstertes „Bitte…“ entkam mir.
„Sag’s nochmal.“
„Bitte…“
„Wofür?“
„Berühr mich. Nimm mich.“
Er lachte leise. Kein Spott – reine Lust.
„Ich werde dich nehmen… später. Jetzt will ich dich nur fühlen. Sehen, wie du zuckst… wenn ich dich nur mit zwei Fingern an der richtigen Stelle halte.“
Dann fand er sie. Die Stelle. Diese kleine, brennende, pochende Stelle, die jede Kontrolle in mir brach.
Er kreiste. Langsam. Sanft. Dann fester.
Meine Knie gaben fast nach. Ich stöhnte. Keuchte. Ich war feucht, so feucht, dass seine Finger glitten wie über Seide.
Und ich kam. Wieder. Stark. Still. Die Lippen auf der Wand. Mein Körper zuckend, bebend, vibrierend in seiner Hand.
Er hielt mich fest. Ruhig. Wartete.
Dann flüsterte er:
„Zieh das Kleid wieder runter. Und geh. Jetzt. Bevor ich’s mir anders überlege.“
Ich keuchte. Konnte kaum stehen. Aber ich gehorchte.
Zitternd. Heiß. Völlig außer mir.
Ich zog das Kleid herunter, drehte mich langsam um. Unsere Blicke trafen sich.
„Geh“, sagte er. „Und überleg dir gut, ob du wieder kommst.“
Der Flur war still.
Ich schloss die Tür leise hinter mir, als hätte es der Moment verdient, dass niemand erfährt, was darin geschah. Kein Laut. Nur das Klicken der Klinke, mein schneller, flacher Atem – und das Pochen zwischen meinen Beinen, das noch nicht nachließ.
Ich ging. Barfuß. Langsam. Das Kleid glitt über meine Haut wie nachglühende Erinnerung. Jeder Schritt war ein Widerhall des Moments, der mich noch immer hielt.
Ich versuchte, mein Gesicht ruhig zu halten. Nicht rot. Nicht nervös. Doch mein Herz schlug so laut, dass ich fürchtete, man könnte es hören – durch Wände, durch Türen, durch Blicke.
In mir: Hitze.
Zwischen meinen Schenkeln war ich feucht. Immer noch. Nicht von ihm. Nicht ganz. Von mir. Von meiner Lust, die so stark gewesen war, dass sie mich überrannt hatte.
Ich kam an unserem Zimmer an. Zögerte. Atmete tief durch.
Dann trat ich ein.
Mein Mann lag im Bett. Im Halbschlaf. Die Decke halb über ihm, sein Kopf im Kissen.
„Hast du sie gefunden?“ murmelte er.
Ich nickte. „Ja. Lag noch da. Glück gehabt.“
Er lächelte im Halbdunkel. „Ich hab dich vermisst, irgendwie. Du warst lang weg.“
Ich lächelte. Setzte mich auf die Bettkante, drehte ihm den Rücken zu, damit er nicht sah, wie sehr meine Hände noch leicht zitterten.
„War warm draußen“, sagte ich leise. „Ich hab kurz noch Luft gebraucht.“
„Du riechst gut“, flüsterte er.
Ich zuckte. Kurz. Denn ich roch nach Haut. Nach Wasser. Und nach etwas anderem. Etwas, das ich nicht benennen konnte, aber an mir haftete wie ein Geständnis.
Ich schlüpfte unter die Decke, vorsichtig. Spürte seine Hand auf meiner Taille. Zärtlich. Wach.
„Ich liebe dich“, flüsterte er.
Ich schloss die Augen. Und sagte es zurück. Weil es stimmte. Und weil die Dinge, die nebeneinander existieren, nicht immer einander ausschließen.
Aber mein Kopf war nicht bei ihm.
Ich sah ihn. Den Mann. Seine Hände. Seine Stimme.
Ich fühlte, wie mein Schoß wieder warm wurde. Wie mein Körper mehr wollte, obwohl er alles bekommen hatte.
Und ich wusste: Es war nicht das letzte Mal.

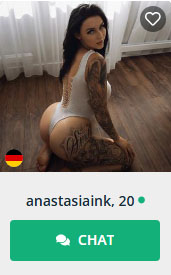

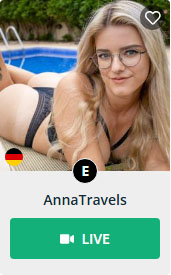
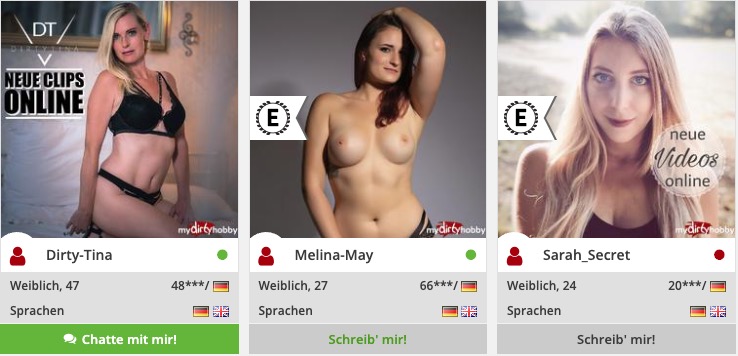
 Suchst Du diskrete und zwanglose Sextreffen mit Frauen?
Suchst Du diskrete und zwanglose Sextreffen mit Frauen?